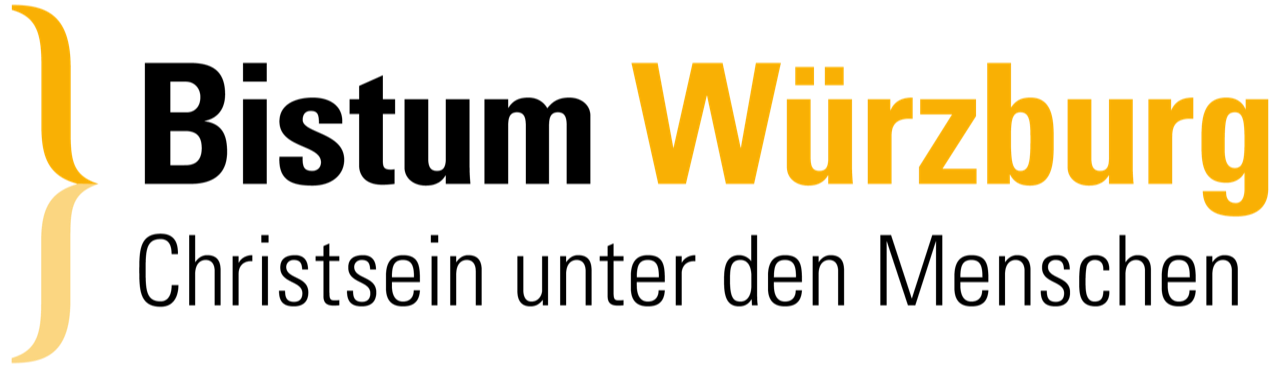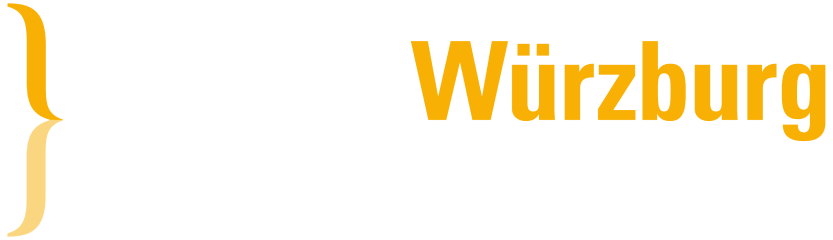1859
Aufgrund der Baufälligkeit der früheren Kirche wurde der Beschluss gefasst, eine neue Kirche zu bauen
1868
Grundsteinlegung der neuen Kirche. Die Steine der alten Kirche wurden zur inneren Ausmauerung der neuen verwendet. Die Kirche errichteten die Baumeister Jessenberger aus Unsleben und Müller aus Bad Neustadt.
12. August 1869
Weihe der Kirche durch den Würzburger Bischof Georg Anton von Stahl. Der Kirchenpatron ist der Heilige Sebastian (20. Januar).
1947, 1961 und 1989 Restaurationen.
Eine Besonderheit der jetzigen Kirche stellen die Glasfenster des Künstlers Burkard Siemsen (*1947) dar.
Das Mittelfenster ist dem Patrozinium der Kirche gewidmet, dem Patrozinium des Hl. Sebastian. Allerdings zeigt dieses Fenster nicht das harte, blutige Martyrium des Heiligen Sebastian, wo er mit Pfeilen beschossen wird. Dies tut die Skulptur an der rechten Stirnwand des Langhauses schon sehr eindringlich. Hier soll vielmehr auf die Gnade verwiesen werden, die wir durch die Glaubenskraft, für die uns der Märtyrer ein Vorbild ist, von Gott empfangen.
Die Martersäule steht isoliert, verlassen, in der Mitte. Aber das Licht der Hoffnung kommt aus dem Göttlichen Licht und strahlt hinein in die Welt, in der es Hell und Dunkel gibt, Gut und Böse. Dafür stehen die beiden angeschnitten Kreise als Zeichen der Vielfalt und der Komplexität des Lebens, die aber hier und da einen Knacks haben, einen Riss, und die überstrahlt werden von den göttlichen Strahlen der Hoffnung.
Die beiden Fenster rechts und links nehmen das Motiv der Martersäule wieder auf, denn die gibt es sowohl vor als auch nach dem Martyrium des Sebastian. Außerdem wird hier der Bogen geschlagen vom Alten zum Neuen Testament.
Links: die flatternden Gebilde erinnern an die Flammen des brennenden Dornbusches. Der Dornbusch, der weiter grünt, weil er nicht verbrennt! Im brennenden Dornbusch erscheint Gott als Kraft, die sich nicht aufzehrt. Sein Wirken bleibt beständig erhalten. Dieser Gott ist den Menschen nahe, was auch immer sein wird. Dieser Gott führt in die Freiheit durch die Kraft seines Geistes.
Rechts: Hier sehen wir ebenfalls 7 Flammen, die als die Flammen des Heiligen Geistes gedeutet werden können.
Und schließlich gehört zu diesen Fenstern noch etwas ganz wesentliches dazu: das Kreuz. Kreuz und Fenster bilden eine Einheit, stehen in einem Bezug zueinander. Auf die Gnade Gottes, die in diesen Fenstern auf so ganz vielfältige Weise dargestellt wird, können wir tatsächlich vertrauen, weil Jesus sich dafür verbürgt hat und aus Liebe zur Welt und zu uns Menschen sein Leben am Kreuz hingegeben hat.
„Christus sprach: Ich bin das Licht der Welt.“
Wie das Glas dieser Fenster können und sollen wir uns von seinem Licht treffen lassen, dieses Licht absorbieren/aufnehmen, und es dann schließlich weitergeben in unserer je eigenen Farbigkeit und Form. Und so werden wir selbst zum Licht der Welt!