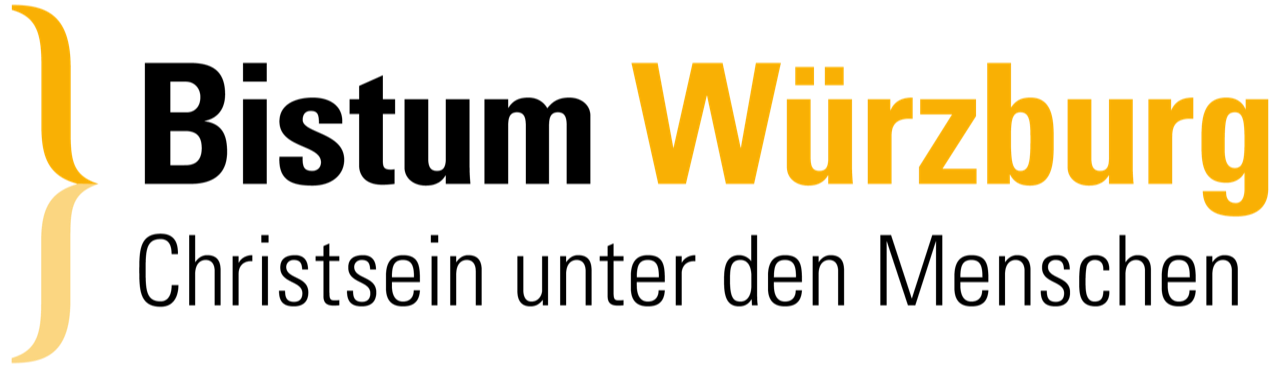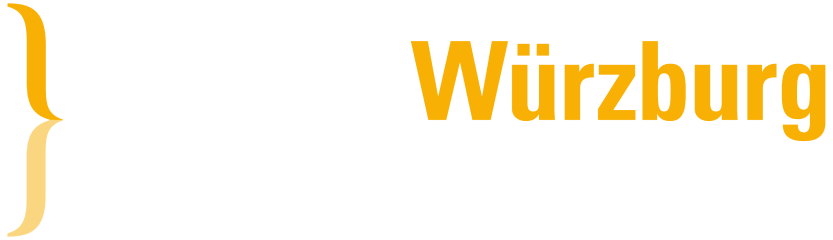Die Stadtpfarrkirche in Mellrichstadt in ihrer prägnanten Silhouette, bestimmend für die Erscheinung der Stadt im Landschaftsbild des Streutales, ist zugleich ein bedeutsames Zeugnis fränkischer Kirchengeschichte. Mit ihren Vorgängerbauten reicht sie in die frühen Zeiten des Christentums in Mainfranken, noch bis in die Jahre vor Gründung des Bistums Würzburg zurück, dessen Geschicke die Stadt und die Pfarrei bis zur Säkularisation 1802 und bis in unsere Zeit teilte. Bereits im Jahr 742 wurde die erste Kirche, welche dem Hl. Martin geweiht war, erwähnt. Der nachfolgende Kirchenbau entstand um 1000 bis etwa 1050 und soll dem hl. Burkhard, dem ersten Bischof von Würzburg geweiht gewesen sein. Von der dritten Kirche ist bekannt, dass sie 1162 von Bischof Heinrich II. von Würzburg zu Ehren der hl. Kilian, Kolonat und Totnan geweiht wurde.
Die Kirche ist aber auch in mehrfacher Beziehung ein kunstgeschichtlich bedeutender Bau. Ungewöhnlich für eine Pfarrkirche ist der gerade geschlossene Chor, der auf eine Beeinflussung durch Baugewohnheiten des Zisterzienserordens schließen lässt. Auch die Lage des Chores zwischen ehemals 2 Osttürmen ist selten bei Pfarrkirchen des mainfränkischen Gebietes. Die Kirche in Mellrichstadt geht mit dieser Eigenart den Kirchen in Münnerstadt, Haßfurt und Gerolzhofen voraus. Originell war die damit verbundene Öffnung der Turmuntergeschosse, der Turmkapellen, sowohl zum Chor wie auch zum Langhaus (wurde erst 1969 zugemauert) hin.
Ursprünglich bestand die Kirche aus 2 Türmen. Leider entzündete am 17. Juni 1496 ein Blitzschlag den südlichen Turm. Ebenso verbrannten der Dachstuhl des Langhauses und die gesamte Einrichtung. Auch schmolzen die Glocken. Das Feuer griff ebenfalls auf die umliegenden Häuser über und ein Großteil der Stadt wurde vernichtet. Der Turm wurde daraufhin nicht wieder aufgebaut. 1582 erhielt der Nordturm eine „welsche Haube".
1585 wurde „durch herrschaftliche Mittel" und auf Betreiben des Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn die Kirche „inwendig ganz renoviert, auch eine neue gemalte Decke von Brettern darein gezeugt" (so im Originaltext aus 1585). An diese Bautätigkeit erinnert die Inschrifttafel an der Südseite des Langhauses aus dem Jahr 1614 mit dem Wappen des Fürstbischofs.
1624 wurde der achteckige Aufsatz des Nordturmes mit doppelter Laterne errichtet.
1710 musste „wegen großer Deformität" und „weil ruinös" das Langhaus der Kirche weitgehend abgebrochen werden. Sie wurde auf den alten Fundamenten neu errichtet.
Bereits 1711 war der Neubau vollendet, wurde allerdings erst 1716 geweiht.
Bei der Renovierung 1969 wurde der Volksalter und der Ambo unter dem Chorbogen errichtet. Gleichzeitig wurden die Arkaden aus dem Kirchenschiff zu den 2 Turmkapellen geschlossen und die Seitenaltäre von den Chorpfeilern weg vor die einstigen Durchgänge gerückt.
Die Kirche ist ein klar gegliederter Bau, eine dreischiffige Hallenkirche, mit einschiffigem, rechteckigem Chor, dessen zwei Joche Kreuzrippengewölbe aus nachgotischer Zeit besitzen.
Das Langhaus hat drei Schiffe von vier Jochen. Im ersten Ostjoch des Langhauses sind beiderseits Kapellen angebaut. Die Anna-Kapelle auf der Nordseite wird 1504 erstmals erwähnt, die, ursprünglich zweigeschossige, Karnerkapelle im Süden bereits 1343.
Auf der oberen, der zweigeschossigen Empore befindet sich eine wunderbare Orgel, welche im Jahr 2004 renoviert wurde.
Die Besonderheit dieser Orgel ist eine Hintergrundorgel hinter dem Hochaltar.
Bei der letzten Innenrenovierung aus dem Jahr 1988 wurde der Innenraum wieder aufgefrischt und in neuen Glanz versetzt.
Innenausstattung
Nach der schriftlichen Überlieferung muss die Kirche in spätgotischer Zeit eine prachtvolle Ausstattung besessen haben. 1580 werden noch zehn Altäre erwähnt, die zumeist aus der Zeit nach dem Brand von 1496 stammten. Die letzten dieser Altäre wurden um 1690 als „altfränkisch" entfernt und durch barocke Ausstattung ersetzt, die sich z.T. bis heute erhalten hat. Am südlichen Seiteneingang steht der spätromanische Taufstein aus der Erbauungszeit der Ostteile. 1616 wurde dieser Taufstein aus der Kirche entfernt und im Pfarrgarten als Wassertrog benutzt. 1969 wurde er in die Kirche zurückgebracht.
Aus gotischer Zeit hat sich das schöne und originelle Sakramentshaus aus dem frühen 15. Jh. erhalten. Ehemals im Chor steht es jetzt in der nördlichen Seitenkapelle.
Aus der Renaissancezeit stammt der reichgeschmückte Taufstein von 1626, Mittelpunkt der Taufkapelle (rechts).
Elmar Will